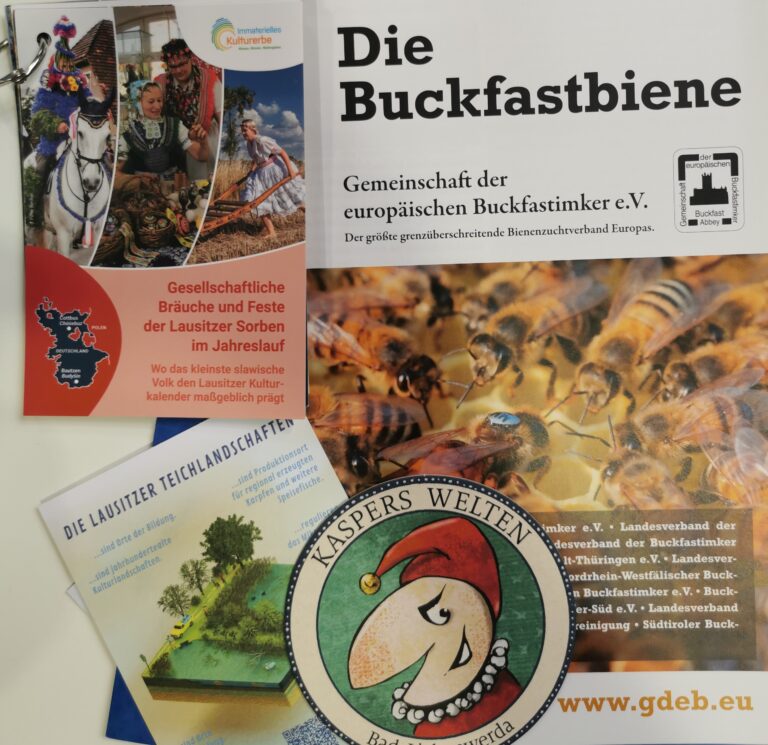Immaterielles Kulturerbe braucht Begegnung – Austauschformat der UNESCO in Cottbus|Chóśebuz setzt starke Impulse
Gemeinsame Pressemitteilung der UNESCO 5– Erbe der Lausitz
Wenn viele Menschen zusammenkommen, wird Erbe besonders lebendig. Das hat die Veranstaltung „IKE-Werkstadt(t) 2025: Wissen. Können. Weitergeben.“ am 2. Juli im IKMZ der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg eindrucksvoll gezeigt.
In Kooperation mit der Deutschen UNESCO-Kommission, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, der Beratungs- und Forschungsstelle für Immaterielles Kulturerbe im Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, dem Sorbischen Institut, dem Spreewaldverein e. V. sowie dem Projekt „UNESCO 5 – Erbe der Lausitz“ wurde ein Raum für Austausch, Begegnung und gemeinsames Weiterdenken geschaffen.
Vielfalt zeigen, Zusammenhänge verstehen
Präsent waren Vertreterinnen und Vertreter aus bereits anerkannten Immateriellen Kulturerben – darunter die Feste und Bräuche der Sorben im Jahreslauf, der Spreewaldkahn, die Glaskunst und der Blaudruck, der Kachelofenbau sowie die Finsterwalder Sänger. Sie alle zeigten, wie lebendiges Kulturerbe aussehen kann – und sprachen offen über die Herausforderungen, die mit Erhalt, Weitergabe und Sichtbarkeit verbunden sind. Gleichzeitig wurde deutlich, welchen positiven Einfluss die Anerkennung als Immaterielles Kulturerbe für das Selbstverständnis und die Strahlkraft einer Tradition haben kann.
Daneben stellten sich zahlreiche Trägergruppen vor, die sich aktuell auf den Weg zur Anerkennung machen. Besonders eindrucksvoll war der Beitrag der Jazzwerkstatt Peitz, der aufzeigte, wie Musik in der DDR Freiräume schuf, die bis heute nachwirken – ein bewegendes Zeugnis kultureller Kontinuität und gesellschaftlicher Wirkung.
Weitere Beispiele waren die Zucht der Buckfastbiene und der Lausitzer Karpfen, beides Ausdruck tiefer handwerklicher Verwurzelung in Natur und Region. Auch der Karneval in Brandenburg, Berlin und Sachsen stand im Fokus – als Kulturform, die über Generationen hinweg Gemeinschaft stiftet und die Vielfalt einer Region sichtbar macht.
Kulturelles Wissen erhalten – neue Wege ermöglichen
Impulse kamen auch von institutioneller Seite: Das Technikmuseum Berlin zeigte, wie immaterielles Wissen in musealen Kontexten vermittelt und bewahrt werden kann. Die Goldschmiedekunst und die Fernmeldetechnik thematisierten die strukturellen Schwierigkeiten im Erhalt traditionellen Fachwissens – aber auch den Wunsch, durch Anerkennung und Austausch neue Wege zu eröffnen.
Was alle Beiträge einte, war der Ruf nach mehr Sichtbarkeit, nachhaltiger Unterstützung und verlässlichen Strukturen. Immaterielles Kulturerbe lebt – aber es lebt nicht von allein. Es braucht Orte, an denen Wissen weitergegeben, Erfahrungen geteilt und Netzwerke geknüpft werden können. Es braucht Rahmenbedingungen, die das Ehrenamt entlasten und langfristiges Engagement ermöglichen.
Musikalischer Brückenschlag
Einen besonderen künstlerischen Akzent setzte der Auftritt der Finsterwalder Sänger, die eigens für den Tag ein mehrstrophiges Werk präsentierten. Mit feinem Humor und gesellschaftlichem Gespür wurde darin die Bedeutung des Immateriellen Kulturerbes ebenso thematisiert wie die Herausforderungen seiner Bewahrung – ein musikalischer Brückenschlag zwischen Tradition und Zukunft.
Ein Auftakt für mehr Zusammenarbeit
Die IKE-Werkstadt(t) 2025 war mehr als eine Veranstaltung – sie war ein Zeichen dafür, dass kulturelles Erbe nur im Miteinander lebendig bleiben kann. Der Tag zeigte eindrucksvoll, wie stark das Potenzial ist, das in den regionalen Traditionen der Lausitz, Brandenburgs und Sachsens steckt – und dass der Austausch darüber gestärkt und fortgeführt werden muss.
Text: Susann Troppa, UNESCO 5 – Erbe der Lausitz, unesco5@lfu.brandenburg.de